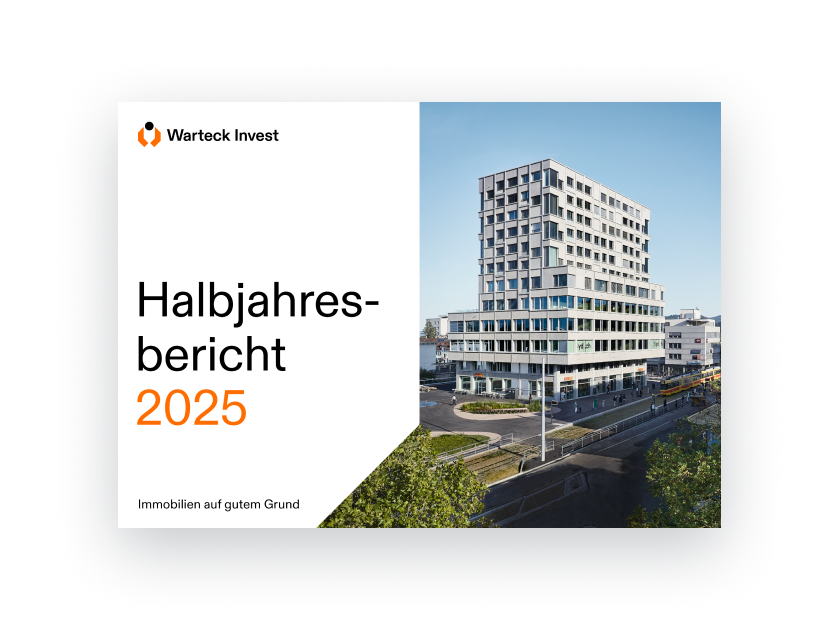Die Zukunft des Reportings ist online

Fünf gute Gründe, warum Unternehmen das Reporting auf die Online-Berichterstattung ausrichten sollten.
Online-Reporting ist in aller Munde. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte werden immer öfter nur noch digital publiziert. Die Option, Berichte gedruckt zu bestellen, ist seit 2016 um 80% gesunken (siehe Studie «Reporting-Perspektiven 2023» für CH und D). vor allem für Investoren und Analysten. Aber auch dieses Format kann längst automatisiert erstellt werden, aus der gleichen Inhaltsquelle. Wir nennen das «Single Source of Truth».
So oder so, die Zeit ist reif für einen Online-Report nach den neusten technischen und funktionalen Standards, gleichermassen für die finanzielle wie auch nicht-finanzielle Offenlegung. Egal, wie sie aktuell oder künftig digital publizieren möchten:
1
Digitalisierungs-Strategie in der Kommunikation
Wenn in Unternehmen Daten aus verschiedenen Quellen integriert und Prozesse automatisiert werden, liegt es nahe auch die Berichterstattung mit einzubeziehen. Ein Online-Report weist weniger Medienbrüche auf uns lässt sich gut mit der IR-Kommunikation auf der Corporate Website und mit Social-Media-Kanälen wie LinkedIn verknüpfen. Letzteres ist sogar ein Muss, um über «Push»-Kommunikation die Besuchsfrequenzen zu steigern. Zudem zeugt eine Webpräsenz auf dem neusten Stand von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
Mit dem Einsatz von audiovisuellen Mitteln und der Verknüpfung mit Social-Media-Kanälen erhalten Ansprechpartner für Investoren ein Gesicht. Aktuelle Studien zeigen, dass besonders CEO-Profile Aufmerksamkeit auf das Unternehmen ziehen.
Ein grosses Plus ist die kollaborative und ortsunabhängige Produktion mit Hilfe von Content Management Systemen, wie zum Beispiel ns.wow von mms. Und mit steigender Zahl der Tabellen (Stichwort Klimaberichterstattung nach OR 964 und TFCD) wird die Automatisierung und Codierung immer wichtiger.
Ein weiterer Vorteil von HTML-Berichten ist, dass Ihre SEO-Performance, also die Sichtbarkeit spezifischer Inhalte der Reports, deutlich höher ist, als jene von PDFs.

2
Mehr Reichweite, weniger Barrieren
Seit 2025 gelten in der EU strengere Regeln bezüglich digitaler Barrierefreiheit (Stichwort Accessibility Act-Richtlinie EAA). In der Schweiz steht eine Teilrevision des Behindertengesetzes (BehiG) bevor. Davon sind auch Unternehmen in der Schweiz betroffen.
Das Layout von HTML-Berichten folgt klar definierten Strukturen und Regeln. Deshalb enthalten sie per se weniger Barrieren als ein PDF. 100-prozentige Barrierefreiheit gibt es nicht, doch ist das HTML-Format besser geeignet zur Erfassung durch Sprachsteuerungssoftware, wie sie zum Beispiel sehbehinderte Menschen einsetzen. Digital verbreitete Produkte möglichst barrierefrei zu gestalten entspricht den steigenden Anforderungen an digitale Zugänglichkeit und verbessert die Nutzbarkeit für alle Stakeholder und minimiert potenzielle rechtliche Risiken. Notabene: «Barrierefreiheit» beginnt bereits beim Strukturieren und Erstellen der Inhalte.
Darüber hinaus sind Online-Berichte immerwährend und schnell verfügbar, egal, wo sich die Leserinnen und Leser gerade befinden. Nahezu die gesamte Bevölkerung nutzt für den Zugang zum Internet ein mobiles Gerät. Die Schweiz liegt über dem europäischen Durchschnitt (Bundesamt für Statistik). Eine aktive Berichtskommunikation auf Social Media wird für Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte zur Norm. In Online-Reporten jedoch sind interaktive Features nach wie vor die Ausnahme.
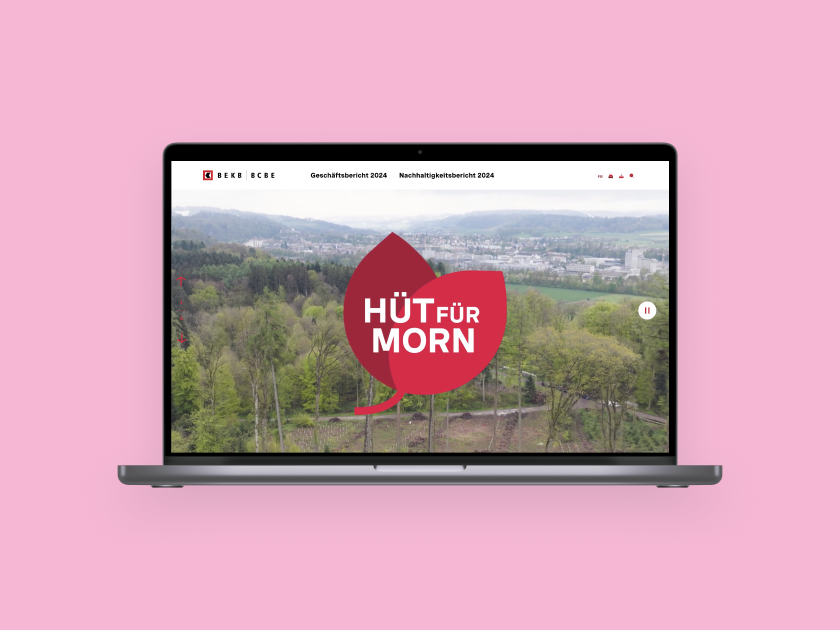
«Barrierefreiheit beginnt beim Schreiben.»
3
Messbarkeit für mehr Impact
Die Kommunikation über HTML-Reports bringt es mit sich, dass die Zahl der Besuche auf den Websites und das Verhalten gemessen werden können, was das Lernen über Inhalte und allfällige Kurskorrekturen ermöglichen. Erkenntnisse aus den Analysen können aber auch dazu benutzt werden, die Auffindbarkeit von spezifischen Informationen über Suchmaschinen zu verbessern.
Zu beachten sind dabei die Datenschutzgesetze und die Praxis, Internet-Usern freizustellen, ob sie das Tracking aktiv ablehnen und die Dienste auf der Website mit Einschränkungen nutzen möchten.
4
Basis für das Tagging
In der Schweiz wird Maschinenlesbarkeit für börsengelistete Unternehmen ab Publikation Geschäftsbericht 2025 regulatorische Pflicht (vgl. die Informationsplattform esg-regulation.info von NeidhartSchön). Behörden verlangen maschinenlesbare Formate wie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) in Berichten. XBRL-Daten können in XHTML-Dokumente eingebettet und so automatisch ausgewertet werden. Von HTML zu XHTML ist es ein kleiner Schritt. Maschinenlesbare Formate ermöglichen eine sprachunabhängige Vergleichbarkeit und erleichtern es Investoren, Analysten und Regulatoren, die Berichte schnell und effizient auszuwerten.

5
Von der Compliance zum Impact
Online-Reports sind nicht an Seitenzahlen gebunden, weshalb der massiv steigende Umfang der Berichte weniger augenfällig ist. Um so wichtiger wird eine mediengerechte Inhaltsstruktur und dass Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten jedes Jahr neues Leben eingehaucht wird. Denn nach der Compliance kommt die Profilierung.
Schweizer Unternehmen berichten vermehrt mit einem übergreifenden Motto (Reporting Perspektiven 2023). Dabei wird über Finanz- und Nachhaltigkeitsthemen zusammen berichtet oder vorsichtig gesagt «integriert», aktuell meist jedoch noch «kombiniert».Das ist nutzerfreundlich, verringert redundante Kommunikation und ist einem konsistenten Messaging zuträglicher. Für eine zielgruppengerechte Ansprache werden in Online-Reports immer häufiger Themenfilter statt Zielgruppenfilter eingesetzt.
Verwendete Quellen und weiterführende Informationen:
Reporting Perspektiven (Center for Corporate Reporting CCR)
Informationen zur BehiG-Revision (Schweizerische Eidgenossenschaft)
Mobile Technologien in der Schweiz im internationalen Vergleich (Bundesamt für Statistik)
Prozesse statt Checklisten für barrierefreie Inhalte (Sophie Johanning. Die Autorin hat einen Workshop bei NeidhartSchön durchgeführt)